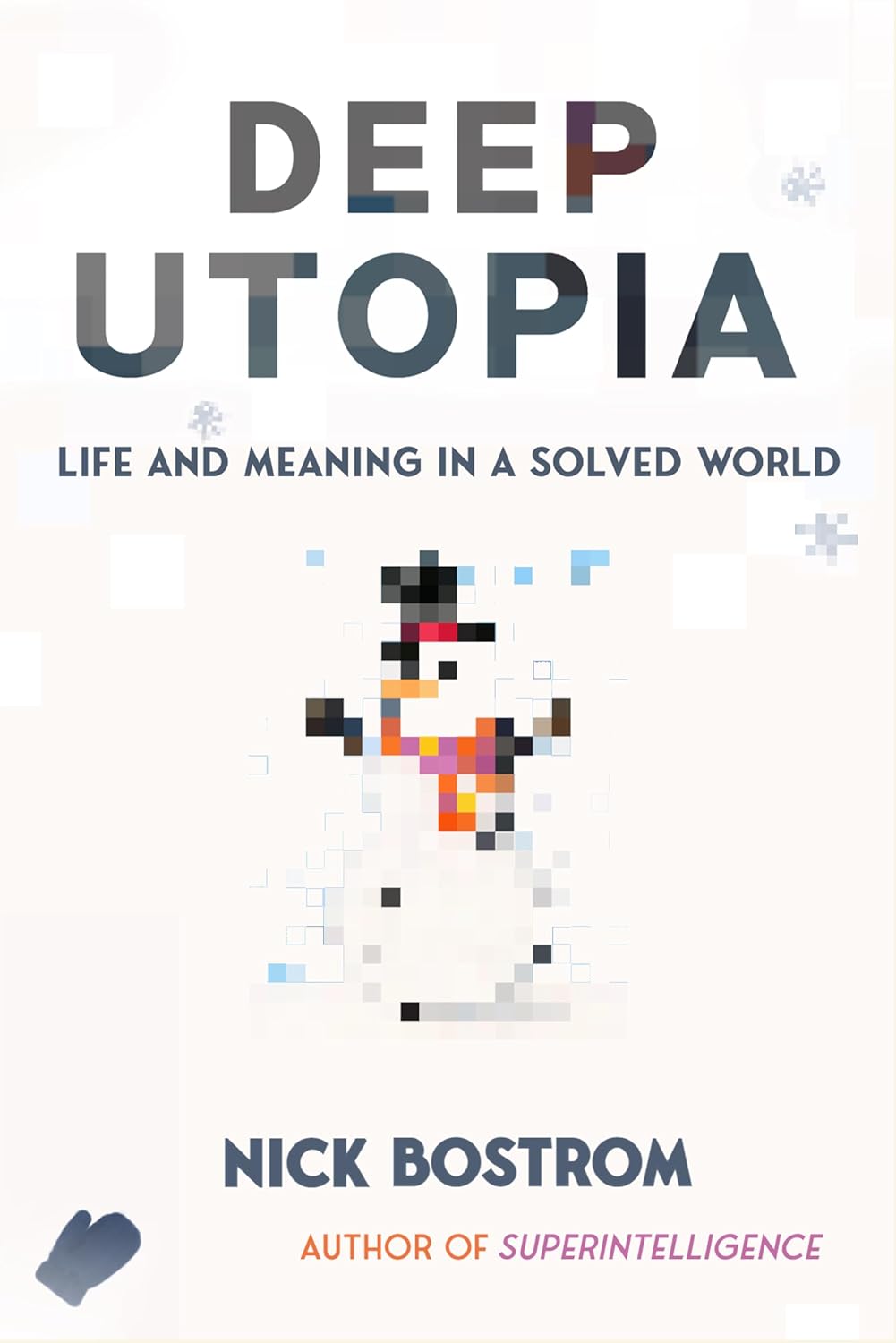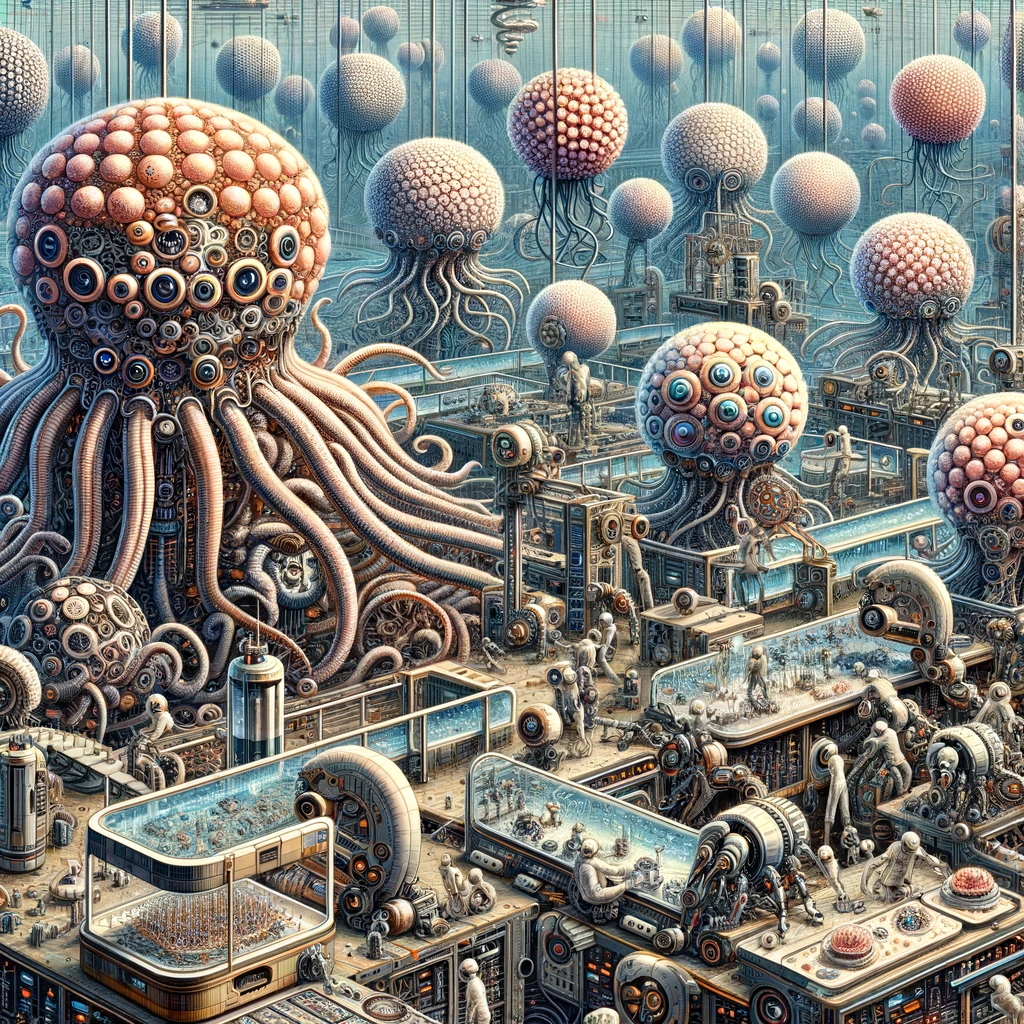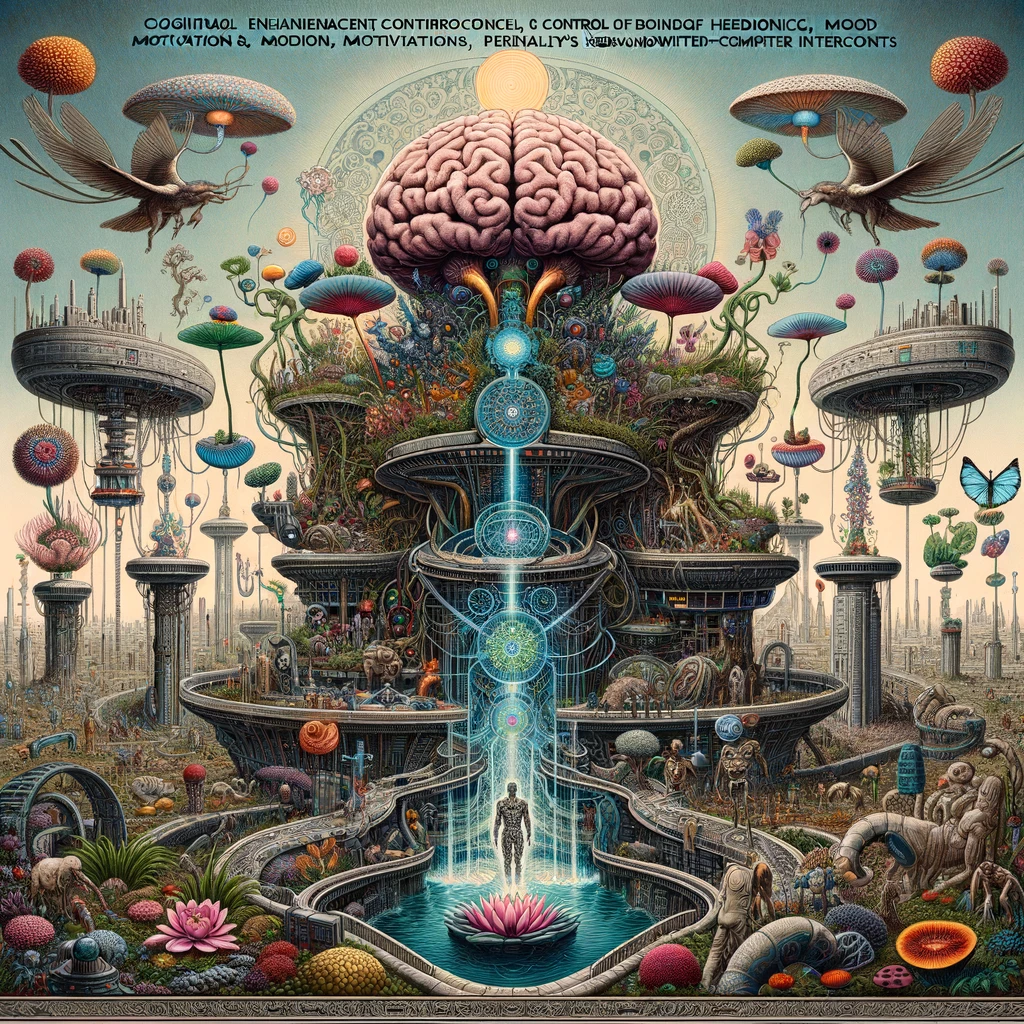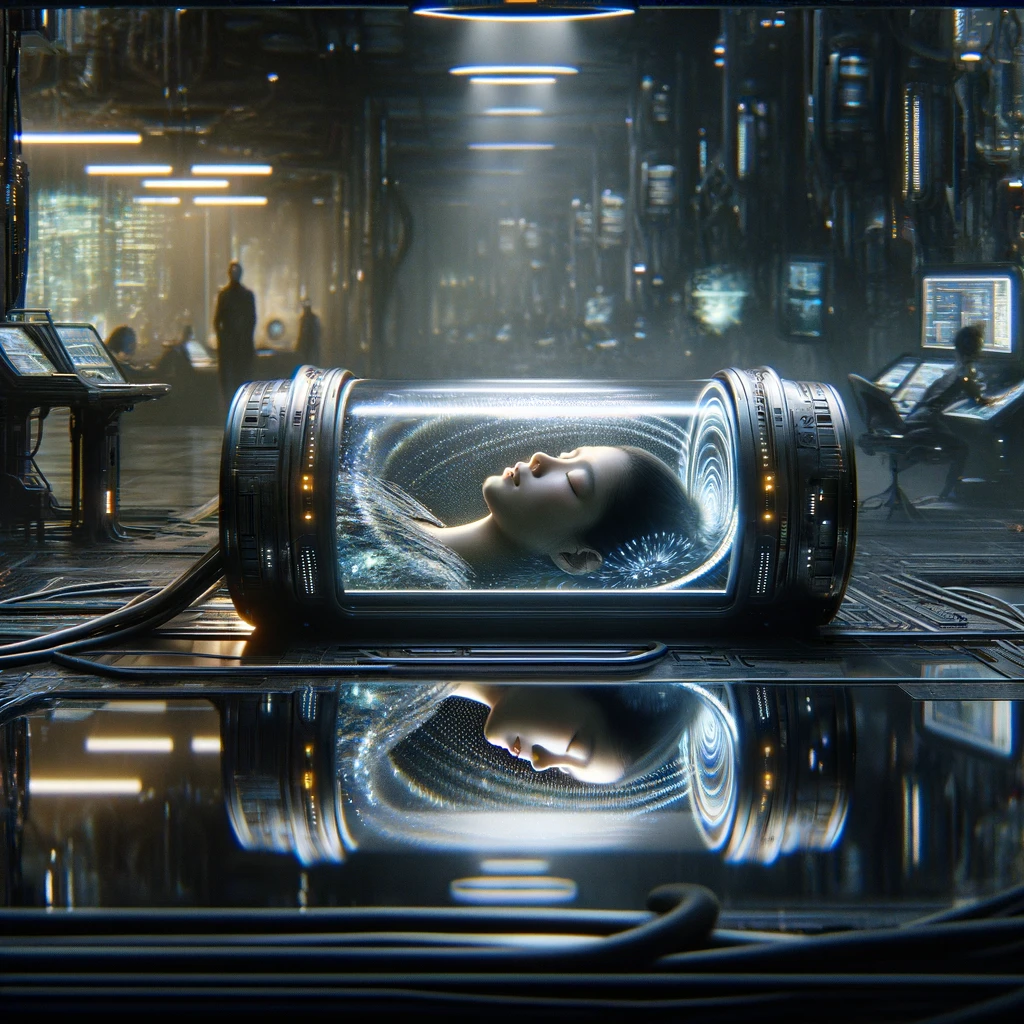Dies ist Teil 2 der Miniserie über Bostroms Deep Utopia
Handout 12: UTOPISCHE TAXONOMIE
Bostroms Zusammenfassung skizziert fünf verschiedene Visionen einer Utopie, die auf einer Skala imaginärer Tiefe angeordnet werden könnten, wobei „Plastic Utopia“ die tiefste von allen darstellt.
Governance & Kulturutopie
Dieser Typ betont ideale Gesetze, Bräuche und gesellschaftliche Organisation. Er ist nicht von Natur aus langweilig, tappt aber oft in die Falle, die menschliche Natur zu ignorieren, wirtschaftliche oder politische Fehler zu begehen oder die Bedürfnisse unterdrückter Gruppen zu übersehen. Zu den Varianten gehören feministische, marxistische, technologische, ökologische und religiöse Utopien, und neuere Ergänzungen wie Krypto-Utopien.
Utopie nach der Knappheit
Gekennzeichnet durch einen Überfluss an materiellen Gütern und Dienstleistungen, der sicherstellt, dass jeder mehr als genug hat, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, mit Ausnahme von Positionsgütern. Diese Utopie geht davon aus, dass die Erde bereits auf dem Weg in die Postknappheit ist, zumindest was die menschlichen Bedürfnisse betrifft, was auf eine deutliche Abkehr von unseren Jäger- und Sammlervorfahren hindeutet.
Post-Work-Utopie
Stellt sich eine Welt vor, in der die Automatisierung die Notwendigkeit menschlicher Arbeitskraft in der Wirtschaft eliminiert. Zwar mag es noch immer einen Bedarf an kultureller Schöpfung geben, doch liegt der Schwerpunkt aufgrund des technologischen Überflusses oder einer Lebensstilentscheidung, die Freizeit der Arbeit vorzieht, auf minimaler menschlicher Arbeit. Diese Utopie untersucht das Gleichgewicht zwischen Einkommen, Freizeit und sozialem Status.
Post-instrumentelle Utopie
Geht über die Post-Work-Idee hinaus, indem es die instrumentelle Notwendigkeit menschlicher Anstrengung eliminiert, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch bei alltäglichen Aktivitäten wie Sport, Lernen und der Wahl von Vorlieben. Dies ist ein radikaleres Konzept, das sich deutlich vom traditionellen utopischen Denken abhebt.
Plastik-Utopie
Die transformativste Form, in der jede gewünschte lokale Veränderung mühelos erreicht werden kann sofern nicht durch eine andere Entität verhindert. Das beinhaltet "Autopotenz” oder die Fähigkeit, sich nach Belieben selbst zu verändern. Diese Art von Utopie setzt das technisch Mögliche mit dem physikalisch Möglichen gleich und suggeriert eine Zukunft, in der die Menschheit durch technologische Fortschritte tiefgreifend verändert wird. Es ist ein Konzept, das außerhalb der Theologie und Science-Fiction weitgehend unerforscht ist.
Im Prinzip besteht eine enorme Chance, unsere Existenz zu verbessern, indem wir unsere emotionalen Fähigkeiten verändern und neu gestalten. In der Praxis besteht jedoch eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass wir uns selbst ruinieren, wenn wir diesen Weg zu unbedacht beschreiten und nicht zuerst ein reiferes Maß an Einsicht und Weisheit erreichen.
Bostrom, Nick. Deep Utopia: Leben und Bedeutung in einer gelösten Welt (Englische Ausgabe) (S.212-213).
Man muss sich nur den aktuellen Trend in der Schönheitschirurgie und der geschlechtsangleichenden Behandlung anschauen, denn das ist ein Warnsignal dafür, wie sehr ästhetische und gesellschaftliche Erwartungen schiefgehen können.
Abgesehen von diesen eher komischen Effekten weist Bostrom zu Recht darauf hin, dass jede willentliche Veränderung die Tendenz hat, pseudo-permanent zu werden. Das heißt, selbst wenn wir unsere emotionale Struktur ändern könnten, würden wir dies möglicherweise nie wollen.
(…) wenn du dich so verändern würdest, dass du nichts anderes willst als die maximale Anzahl an Büroklammern, würdest du dich nicht wieder in ein Wesen verwandeln wollen, das andere Dinge will als Büroklammern,
Bostrom, Nick. Deep Utopia: Leben und Bedeutung in einer gelösten Welt (englische Ausgabe) (S.213).
Autopotenz ist daher der Begriff, der am meisten Klärung bedarf, weil ich das Gefühl habe, dass er zu einigen paradoxen Ergebnissen führt, die sich möglicherweise selbst widerlegen. In einem groben Sinne könnten wir argumentieren, dass wir, wenn wir den Menschen einen freien Willen zugestehen (was nicht jeder tut), bereits eine gewisse Autopotenz haben könnten, wenn wir uns in einer Simulation befinden. Wenn wir völlig autopotente Wesen wären, hätten wir uns für eine Existenz entscheiden können, in der wir ein weltberühmter schwedischer Philosoph sind, der ein Buch über tiefe Utopie schreibt, und wir hätten uns wünschen können, unsere Autopotenz loszuwerden, indem wir wirklich das Blut, den Schweiß und die Tränen erfahren, die es kostet, ein tiefgründiges Buch über utopische Themen zu schreiben.
Da eine plastische Autopotenz-Utopie, in der wir für alle Ewigkeit zu allem, überall und gleichzeitig fähig sind, weitgehend sinnlos wäre, könnten Geister wie der unsere eine tiefe Nostalgie für die Zeit empfunden haben, in der wir einfach nur Menschen waren, und dann einen Geisteszustand nachgebildet haben, in dem wir alle unseren Status als Gottheit vergessen und einfach zufällig in eine Simulation mit anderen Geistern gesteckt werden, die sich dasselbe wünschen. Ein gigantischer Themenpark, der einen der möglichen Multiversum-Stränge vom Beginn des 21. Jahrhunderts nachbildet.
Wenn wir effektive Autopotenz erreichen, könnte unsere erste Intuition sein, dass wir das universelle Langeweileproblem aus Handout 9 gelöst haben. Wenn wir uns subjektiv unerträglich, dann liefen wir Gefahr, eine Zukunft zu schaffen, die objektiv langweilig ist. Der springende Punkt dabei ist, dass alle Emotionen einen wichtigen Zweck haben, auch wenn wir Emotionen entlang eines positiven und negativen Spektrums kategorisieren. Langeweile zum Beispiel lenkt uns von uninteressanten zu interessanten Dingen. Einige, wenn nicht die meisten negativen Emotionen könnten technologisch über Emotionsprothesen oder -apparate externalisiert werden, die von unserer persönlichen KI überwacht werden, sodass wir, wenn eine andere Person etwas Gemeines sagt, nicht wirklich wütend werden, sondern unsere pAI (persönliche KI) uns signalisiert, diese Person in Zukunft zu meiden oder sie einfach zu ignorieren.

Vier ätiologische Hypothesen über den Ursprung des Wertes der Interessantheit in einer langfristigen Perspektive
Der Kern des Zweckproblems liegt in der Frage, ob ein unendliches Universum unendlich viele interessante Dinge für autopotente Entitäten bei Tech-Mat bereitstellen kann. Bostrom identifiziert 4 kategorische Probleme:
- Erkundung: Das Lernen neuer Dinge ist ein evolutionäres Anpassungsverhalten in einer Umgebung, in der es häufig zu Knappheit kommt und die sich ständig ändert. Bei Autopotenz scheint die ganze Vorstellung von Lernen als Anpassungsstrategie sinnlos, da es keinen existentiellen Druck gibt, diese Art von Neugiermotor anzutreiben. Ein langfristig denkendes Gehirn könnte auch auf Probleme mit der Speicherung von Erinnerungen stoßen (siehe Handout 14 unten).
- Signalisierung: Etwas ist für uns interessant, weil es uns in einem sozialen Kontext für andere interessant erscheinen lässt. Sogar bei Tech-Mat gibt es Positions- und Kardinalwerte, die unsere Zeit wert sein sollten. Aber in Verbindung mit den 4th Hypothese, wir könnten in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.
- Spandrel: Interessantheit ist eine Ableitung anderer Werte
- Vermeidung von Routine: Interessantheit ist ein evolutionäres Mittel, um nicht in sinnloser Wiederholung steckenzubleiben. Bei Tech-Mat könnten Routinevermeidung und Signalisierung sehr wohl in einem Teufelskreis steckenbleiben: Da beispielsweise jede Aktivität unendlich ausgedehnt werden könnte und Langeweile eine der letzten universellen Einschränkungen ist, könnte es Olympische Spiele geben, die die sinnlosesten Disziplinen verfolgen (wie das Zählen von Grashalmen) und die Toleranz gegenüber Langeweile könnte in Betracht gezogen werden. Bostrom gibt hier ein Beispiel einer seiner denkwürdigsten Vorlesungen, in der er sich zu Tode langweilte. Dies führt zu einigen paradoxen Situationen, in denen Interessantheit und Langeweile an entgegengesetzten Enden des Anziehungsspektrums eines Geistes zu liegen scheinen, aber die Positionsbewertung unseres Geistes scheint zu solchen Bewertungen zu führen, dass das langweiligste Zeug spezieller sein könnte als das zweitinteressanteste, dem wir je begegnet sind.

Handout 14: Gedächtnisspeicher für Unsterbliche
1. Die maximale Menge an Informationen (Bits), die sich ein Gehirn merken kann, steigt linear mit seiner Größe.
2. Um die derzeitige Geschwindigkeit der Ansammlung von Fähigkeiten und Erfahrungen aufrechtzuerhalten, müsste das menschliche Gehirn jedes Jahrhundert um 14 Deziliter wachsen. In Wirklichkeit könnte dieser Anstieg jedoch auf viel weniger optimiert werden.
3. Auch nach der Migration auf ein optimierteres Speichermedium ist für die Ansammlung von Langzeitgedächtnissen noch immer eine lineare Volumenzunahme erforderlich, wenn auch in einem langsameren Tempo (etwa 1 cm³/Jahrhundert).
4. Eine deutliche Vergrößerung des Gehirns könnte aufgrund größerer Distanzen zu einer langsameren Signalübertragung führen, insbesondere bei Gedanken, die Informationen aus weit voneinander entfernten Regionen integrieren.
5. Die aktuelle Axonleitgeschwindigkeit beträgt etwa 100 Meter/Sekunde, was auf eine physikalische Größenbeschränkung des Gehirns schließen lässt, ohne dass die Denkprozesse dabei wesentlich verlangsamt werden.
6. Der Einsatz von Glasfasern könnte theoretisch ein Gehirn mit einem Durchmesser von bis zu 300 km ohne nennenswerte Verzögerung bei der Signalübertragung versorgen.
7. Wenn man die Erinnerungen eines ganzen Jahrhunderts in einem Kubikzentimeter Raum speichern könnte, könnte man mehr als 10²² Jahrhunderte leben, ohne dass Langzeiterinnerungen verloren gehen.
8. Anpassungen wie ein effizientes Abrufsystem für Fähigkeiten und Erinnerungen wären notwendig.
9. Eine Verlangsamung des Systems könnte die maximale Größe des Speicherspeichers weiter erhöhen, indem größere Gehirne ohne inakzeptable Signalverzögerungen ermöglicht würden.
10. Das Leben in der virtuellen Realität und die Verlangsamung des subjektiven Erlebens könnten die Wahrnehmung einer Verlangsamung abmildern.
11. Eine deutliche Beschleunigung der Denkprozesse würde zwar die maximal mögliche Gehirngröße verringern, könnte aber bei der derzeitigen physischen Gehirngröße für viel mehr Speicher sorgen.
12. Es besteht ein Kompromiss zwischen Langlebigkeit und der Komplexität/Kapazität unseres Geistes. Wir könnten uns dafür entscheiden, viel länger mit einfacheren Geistern zu leben oder komplexere Geister, aber eine kürzere Lebensspanne zu haben.
13. In einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation könnte es möglich sein, sowohl eine lange Lebensspanne als auch ein hochleistungsfähiges Gehirn zu erreichen und so ein Gleichgewicht zwischen Langlebigkeit und Komplexität herzustellen.

Handout 15 Optimale Transzendenz
Unter normalen Umständen schwächt sich unsere Verbindung zu zukünftigen Selbsten jedes Jahr um 1% ab, aber eine „abrupte Metamorphose“ in einen posthumanen Zustand würde eine sofortige Verringerung um 90% bewirken. Wenn man bedenkt, dass die natürliche Erosion über 230 Jahre zu einer ähnlichen Verringerung führen würde, dient dieser Zeitraum als Grenze dafür, wie lange wir die Metamorphose verzögern möchten, um die persönliche Identität zu bewahren. Der intrinsische Wert unserer menschlichen Existenz, neben dem Potenzial für ein viel längeres und möglicherweise doppelt so lohnendes posthumanes Leben, erschwert die Entscheidung jedoch. Die Attraktivität des Übergangs steigt, wenn wir die Möglichkeiten und Werte des menschlichen Lebens erschöpft haben, was auf einen Punkt hindeutet, an dem die Vorteile des Posthumanismus die Kosten überwiegen. Wenn Posthumane zudem eine langsamere Erosion der Selbstverbindung erleben, würde dies für einen schnelleren Übergang zur Posthumanität sprechen.
fortgesetzt werden