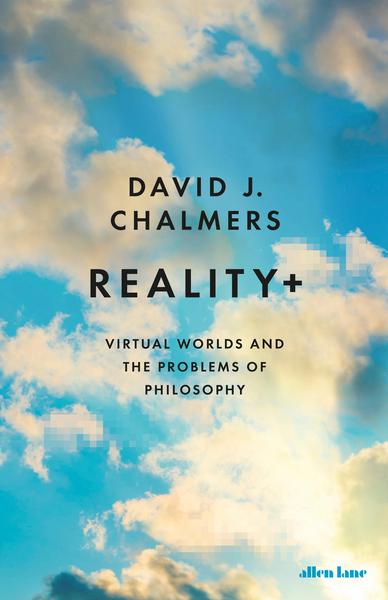Dies ist der zweite Teil der Reality#-Reihe, der zur Diskussion über David Chalmers‘ Buch beiträgt Realität+

Virtuelle und mögliche Welten
Eine Traumwelt ist eine Art virtuelle Welt ohne Computer. (Chalmers, S. 5)
Simulationen sind keine Illusionen. Virtuelle Welten sind real. Virtuelle Objekte existieren wirklich. (Chalmers, S. 12)
Viele Menschen haben in den heutigen virtuellen Welten bedeutungsvolle Beziehungen und Aktivitäten, obwohl vieles fehlt, was wichtig ist. Richtige Körperberührung, Essen und Trinken, Geburt und Tod und mehr. Aber viele dieser Einschränkungen werden durch die vollständig immersive VR der Zukunft überwunden. Im Prinzip kann das Leben in der VR genauso gut oder genauso schlecht sein wie das Leben in einer entsprechenden nicht-virtuellen Realität. Viele von uns verbringen bereits sehr viel Zeit in virtuellen Welten. In Zukunft könnten wir uns durchaus der Option gegenübersehen, mehr Zeit dort zu verbringen oder sogar den Großteil oder unser ganzes Leben dort zu verbringen. Wenn ich Recht habe, wird dies eine vernünftige Wahl sein. Viele würden dies als Dystopie betrachten. Ich nicht. Sicherlich können virtuelle Welten dystopisch sein, genau wie die physische Welt. (…) Wie bei den meisten Technologien hängt es ganz davon ab, wie VR verwendet wird, ob sie gut oder schlecht ist. (Chalmers, S. 16)
Computersimulationen sind in Wissenschaft und Technik allgegenwärtig. In Physik und Chemie gibt es Simulationen von Atomen. Und Molekülen. In der Biologie gibt es Simulationen von Zellen und Organismen. In der Neurowissenschaft gibt es Simulationen von neuronalen Netzwerken. In der Technik gibt es Simulationen von Autos, Flugzeugen, Brücken und Gebäuden. In der Planetenwissenschaft gibt es Simulationen des Erdklimas über viele Jahrzehnte. In der Kosmologie gibt es Simulationen des bekannten Universums als Ganzes. Im sozialen Bereich gibt es viele Computersimulationen des menschlichen Verhaltens (…) 1959 wurde die Symbol Metrics Corporation gegründet, um zu simulieren und vorherzusagen, wie die Botschaften unserer politischen Kampagnen verschiedene Wählergruppen beeinflussen würden. Man sagte, dass diese Bemühungen einen erheblichen Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahlen von 1960 hatten. Die Behauptung mag übertrieben gewesen sein, aber seitdem sind soziale und politische Simulationen zum Mainstream geworden. Werbefirmen, politische Berater, Social-Media-Unternehmen und Sozialwissenschaftler erstellen ganz selbstverständlich Modelle und führen Simulationen menschlicher Populationen durch. Die Simulationstechnologie verbessert sich schnell, aber sie ist noch lange nicht perfekt. (Chalmers, S. 22)
In der realen Welt hat sich Leben auf der Erde entwickelt, doch Chalmers schlägt mögliche Welten vor, in denen das Sonnensystem nie entstanden ist. Er geht sogar noch weiter und schlägt mögliche Welten vor, in denen der Urknall nie stattgefunden hat. Ich halte diese Argumentation für höchst zweifelhaft. Meiner Ansicht nach verwendet Chalmers den Begriff „möglich“ zu freizügig. Was bedeutet es, zu behaupten, dass es eine mögliche Welt gibt, in der sich kein Universum entwickelt hat? Eine solche Behauptung scheint die Grenzen unserer Sprache bis an ihre Grenzen auszureizen.
Mir scheint, dass David Chalmers zu weit geht, wenn er von „möglichen Welten“ spricht. Dieser Begriff der Möglichkeit ist bereits in seinen früheren Werken wie „The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory“ (1996) vorhanden.
Chalmers verwendete das Konzept dann, um den modalen Realismus zu diskutieren, die Idee, dass andere mögliche Welten genauso real sind wie die tatsächliche Welt. Dies war eine radikale Abkehr von der gängigeren Ansicht, die als Aktualismus bekannt ist und bei der nur die tatsächliche Welt als wirklich real angesehen wird.
Chalmers verwendet den Begriff der möglichen Welten vor allem im Zusammenhang mit seinem Konzept der „Zombiewelten“. Dabei handelt es sich um Welten, die physisch mit unseren identisch sind, in denen jedoch keine Bewohner ein Bewusstsein haben. Sie verhalten sich, als ob sie ein Bewusstsein hätten, aber es gibt keine subjektive Erfahrung – daher sind sie „Zombies“. Die Möglichkeit einer solchen Welt wird von Chalmers genutzt, um das schwierige Problem des Bewusstseins zu begründen: die Frage, warum und wie physikalische Prozesse im Gehirn zu subjektiven Erfahrungen führen.
Schauen Sie sich an, welche wahren Schrecken unsere Sprache hervorrufen kann, wenn wir den Konjunktiv nicht richtig verwenden:
1. Ich wünschte, ich wäre nicht so gut darin, schrecklich zu sein.
2. Wenn ich nur jemand anderes wäre, der nicht ich ist.
3. Ich wünschte, ich würde nicht auf unmögliche Träume hoffen.
4. Wenn ich hinsichtlich meines Pessimismus nur weniger optimistisch wäre.
5. Ich wünschte, ich wäre mir meiner Gewissheit nicht so unsicher.
Chalmers' Konzept möglicher Universen scheint Universen zuzulassen, in denen alle in den obigen Sätzen ausgedrückten Möglichkeiten eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit hätten, wahr zu werden.
1. Wenn es ein mögliches Universum gäbe, in dem alles sicher ist, wäre nichts ungewiss.
2. In einem möglichen Universum, in dem Widersprüche möglich sind, wird das Konzept der Möglichkeit unmöglich.
3. Wenn es ein mögliches Universum ohne Beschränkungen gäbe, wäre die Idee der Möglichkeit selbst begrenzt.
4. In einem möglichen Universum, in dem alle Möglichkeiten verwirklicht sind, gäbe es keinen Platz für die Möglichkeit der Unmöglichkeit.
5. Wenn es ein mögliches Universum gäbe, in dem alles unmöglich ist, würde der Begriff der Möglichkeit seine Bedeutung verlieren.
Was bedeutet es, ein unmögliches Universum zu simulieren?
Fehlerhafte Klassifizierungen

Chalmers diskutiert das Konzept reiner, unreiner und gemischter Simulationen. Neo aus dem Film „Matrix“ ist ein unreiner Sim, da sein Geist nicht simuliert ist. Das Orakel hingegen ist ein reiner Sim, da ihr Geist Teil der Simulation ist. Dies sind zwei verschiedene Versionen der Simulationshypothese. Wir könnten Bio-Sims sein, die mit der Matrix verbunden sind, oder wir könnten reine Sims sein, deren Geist Teil der Matrix ist.
Die Hinzufügung einer dritten Kategorie, „gemischte Simulationen“, verwirrt mich, da sie mit einer „unreinen Simulation“ identisch zu sein scheint; es handelt sich nicht einmal um einen Sonderfall. Darüber hinaus wird das spezielle Szenario, in dem eine Simulation nur Biosysteme enthält, was man wohl als „reine unreine Simulation“ betrachten könnte, nicht einmal erwähnt.
Dieses Klassifizierungssystem ist sehr verwirrend. Auch seine Definitionen von „globalen“ und „lokalen“ Simulationen müssen verbessert werden. Seine Unterscheidungen wie „temporäre“ und „permanente“ Simulationen, „perfekte“ und „imperfekte“ Simulationen verraten mehr über unseren Sprachgebrauch als über die Nützlichkeit dieser Simulationskategorien.
Meiner Meinung nach wäre es besser, diese Typen als geschlossene Simulationen (alle an einer Simulation beteiligten Subjekte und Objekte sind in der Simulation enthalten; es gibt beispielsweise nur NPCs) und offene Simulationen (organische Biosimulationen können teilnehmen und digitale Avatare bewohnen, aber in den meisten Fällen wird es immer synthetische Subjekte geben, die die Simulation bereichern) zu bezeichnen. Tertium non datur. Es gibt keine dritte Kategorie, die sowohl offen als auch geschlossen ist, jede mögliche Simulation ist in diesen beiden Gruppen enthalten.
Könnten Simulationen das am schwierigsten zu beschreibende menschliche Phänomen mit der mathematischen Mengenlehre sein? Wir wissen aus der Geschichte, wie Gödels Zerstörung der Mengenlehre letztlich die Träume von Russell und Whitehead, ein perfektes mathematisches System zu entwickeln, zerstörte.
Wenn ein simuliertes Gehirn ein biologisches Gehirn genau widerspiegelt, wird die bewusste Erfahrung dieselbe sein. Wenn das stimmt, dann können wir ebenso wie wir niemals beweisen können, dass wir uns nicht in einer unreinen Simulation befinden, niemals beweisen, dass wir uns nicht in einer reinen Simulation befinden. (Chalmers, S. 34)
Es scheint, als sei David Chalmers mit Konzepten wie der Chaostheorie, Lorenz-Attraktoren, dynamischen Systemen, dem Schmetterlingseffekt usw. nicht vertraut. Gäbe es Lebewesen, die willentlich zwischen Simulationsebenen wechseln könnten, würden sie wahrscheinlich jegliche Orientierung verlieren, was oben und was unten ist. Diese Desorientierung ist vergleichbar mit dem, was Lawinenüberlebende oder Tiefseeforscher erleben könnten. Oben und unten werden zu bedeutungslosen Konzepten.
Diese Situation wird im Film „Inception“ thematisiert, wo eine der Hauptfiguren glaubt, dass die sogenannte „Basisrealität“ nur eine weitere Ebene einer Traumwelt ist, und versucht, der Simulation durch Selbstmord zu entkommen.
Hat unser Bewusstsein eine Art Gravitationskraft, die uns daran hindert, vollständig in Realitäten einzutauchen, die nicht die Realität sind, in die wir hineingeboren wurden – unsere Mutterrealität sozusagen? Und könnte die Reisekrankheit, die wir von VR bekommen, wenn wir zu lange darin versunken sind, eine körperliche Empfindung dieses Entfremdungseffekts sein? Könnte unser Schlafbedürfnis darauf hinweisen, dass wir nicht hierher gehören? Sollte die Evolution auf lange Sicht nicht Arten bevorzugen, die keine Ruhe brauchen? Ruhen und Schlafen macht jedes Tier maximal anfällig für seine Umwelt und ist zudem für die Fortpflanzung nutzlos.
Pseudoqualifizierende Attribute
Eine Vielzahl von Problemen mit Chalmers' Argumentation rührt von der Tatsache her, dass er sich nicht darüber im Klaren zu sein scheint, wie er bestimmte Attribute verwendet. Es gibt eine Klasse von Attributen in unserer Sprache, die als „verschwommen“ beschrieben werden können. Wenn wir sie genau untersuchen, können wir uns sie kurzzeitig schärfer vorstellen, als sie es tatsächlich sind. Was bedeutet es, Pi einen genauen Wert zuzuweisen? Während die Aussage in natürlicher Sprache vernünftig erscheint, würde jemand, der mit dem Konzept irrationaler Zahlen vertraut ist, auf den Fehler hinweisen.
Ich behaupte, dass Wörter wie „perfekt“, „unperfekt“, „rein“, „unrein“, „präzise“ usw. zu einer Kategorie pseudobinärer Attribute unserer Sprache gehören. In unseren Köpfen fügen wir am Ende dieser Attribute oft Qualifizierungen wie „genug“ hinzu. Die Verwendung solcher Wörter kann eine mentale Abkürzung sein, ist aber möglicherweise irreführend.
Betrachten Sie einen Satz von Seite 35: „Eine perfekte Simulation kann als eine Simulation definiert werden, die die Welt, die sie simuliert, genau widerspiegelt..“ Auf den ersten Blick scheint dieser Satz vernünftig. Aber bei genauerem Hinsehen wird der Inhalt dieses Satzes, insbesondere die Verwendung des Wortes „Spiegelung“, fragwürdig. In unserer Alltagssprache kann „Spiegelung“ eine visuelle Bedeutung haben, wie die Reflexion, die wir in einem Spiegel sehen. Aber eine Reflexion ist nicht identisch mit dem Originalobjekt – es ist eine Umkehrung. Was bedeutet es also, wenn eine Reflexion unvollkommen ist oder ungenau spiegelt?
Stellen wir uns einen erfahrenen Schauspieler vor, der unsere Bewegungen vor einem Spiegel nachahmt und so die perfekte Illusion erzeugt, dass wir unser eigenes Spiegelbild sehen. Ein unvollkommener Spiegel kann entstehen, wenn der Schauspieler einen unserer Mikroausdrücke übersieht oder zu langsam ist, um unsere Handlungen nachzuahmen, wodurch die Illusion entlarvt wird. Ich glaube, dass Chalmers mit seiner Terminologie genau darauf anspielt.
Darüber hinaus ist selbst eine echte Spiegelung keine „perfekte“ Spiegelung. Die Zeit, die die Lichtstrahlen brauchen, um von meinen Augen zum Spiegel und dann zu meiner Netzhaut und in mein Sehsystem zu gelangen, führt zu einer Verzögerung. Die Synchronizität meiner Bewegungen und meiner Spiegelung ist eine Illusion, die unser Gehirn bequemerweise außer Kraft setzt.
Dies ist analog zu der Illusion, dass unser Sehvermögen konstant ist und kontinuierlich Informationen aufnimmt, während unsere Augenbewegungen in Wirklichkeit sporadisch sind. Für unser Gehirn ist es bequemer, diese Diskontinuitäten zu ignorieren. Wir bemerken auch nie den blinden Fleck in unserem Sichtfeld, den unser Gehirn ausfüllt.
In diese Kategorie fällt auch die Tendenz in der Philosophie, Dinge wie Probleme und Philosophieschulen mit beschreibenden Adjektiven wie „hart“ und „stark“ zu benennen.
„Das ist das schwierige Problem des Bewusstseins.“
„Er ist ein starker Idealist.“
„Das ist ein schwaches Argument.“
Es gibt sogar eine Reihe von Objekten, über die man nur schwer diskutieren kann: Löcher. Löcher gelten weithin als etwas Schlechtes. Argumentationen können Löcher haben. Schwarze Löcher verzerren die Realität. Ist ein Loch überhaupt real? In der Topologie bezieht sich der Begriff „Gattung“ auf eine Eigenschaft eines topologischen Raums, die eine intuitive Vorstellung von der Anzahl der „Löcher“ oder „Griffe“ einer Oberfläche erfasst. Es ist ein Schlüsselkonzept bei der Klassifizierung von Oberflächen. Wenn die Mathematik das also sagt, muss es real sein.
Unsere Sprache erlaubt Sätze wie „Er entfernte das Loch aus der Wand.“ Ein Loch ist ein Ding, das man messen, aber nicht wiegen kann. Viele intuitive Annahmen geraten ins Wanken, wenn man mit der Realität konfrontiert wird, dass jeder Löcher kennt und jeder Löcher geschaffen hat, es aber nichts Greifbares gibt, das dies belegt.
 Die Digital Mind Illusion, ein psychologisches Experiment
Die Digital Mind Illusion, ein psychologisches Experiment
Die Rubber Hand Illusion (RHI) ist ein bekanntes psychologisches Experiment, das das Gefühl der Körpereigentümerschaft untersucht und zeigt, wie unsere Selbstwahrnehmung formbar ist und durch multisensorische Integration manipuliert werden kann.
Bei dieser Illusion sitzt eine Person an einem Tisch, ihre linke Hand ist verdeckt, und vor ihr wird eine falsche Gummihand platziert. Dann werden sowohl die echte Hand als auch die Gummihand gleichzeitig mit einer Bürste gestreichelt. Nach einiger Zeit beginnen viele Menschen, die Gummihand als ihre eigene zu empfinden, sie haben das Gefühl, als käme die Berührung, die sie spüren, von der Gummihand und nicht von ihrer echten. Diese Illusion veranschaulicht, wie visuelle, taktile und propriozeptive Informationen (das Gefühl für die relative Position der eigenen Körperteile) kombiniert werden können, um unser Gefühl des körperlichen Selbst zu verändern.
Die Auswirkungen von RHI auf Bewusstseinstheorien sind tiefgreifend. Es zeigt, dass die Wahrnehmung unseres Körpers und unseres Selbst eine Konstruktion des Gehirns ist, die nicht nur auf direkten internen Informationen, sondern auch auf externen sensorischen Eingaben basiert. Unsere bewusste Erfahrung unseres Körpers ist keine statische, feste Sache – sie ist dynamisch und wird ständig auf der Grundlage der verfügbaren Informationen aktualisiert.
Eine einflussreiche Theorie des Bewusstseins, die Embodied Cognition Theory, geht davon aus, dass unsere Gedanken, Wahrnehmungen und Erfahrungen durch die Interaktion zwischen unserem Körper und der Umwelt geprägt werden. Das RHI-Experiment unterstützt diese Theorie, indem es zeigt, wie veränderte Sinneseindrücke die Wahrnehmung unseres Körpers verändern können.
Darüber hinaus wurde die Gummihand-Illusion verwendet, um die neuronalen Korrelate des Bewusstseins zu erforschen – also welche Teile des Gehirns an der Entstehung bewusster Erfahrungen beteiligt sind. Studien haben gezeigt, dass beim Erleben der Illusion eine erhöhte Aktivität im prämotorischen Kortex und im intraparietalen Sulcus auftritt – Bereiche des Gehirns, die an der Integration visueller, taktiler und propriozeptiver Informationen beteiligt sind.
Insgesamt demonstriert das RHI die Formbarkeit unserer bewussten Selbsterfahrung, unterstützt Bewusstseinstheorien, die die Rolle der multisensorischen Integration und Verkörperung betonen, und hilft, die neuronalen Korrelate dieser bewussten Erfahrungen zu identifizieren. (…)
Das Experiment „Rubber Hand Illusion“ (RHI) und ähnliche Experimente verdeutlichen, dass unser Realitätssinn, zumindest auf der Ebene der persönlichen körperlichen Erfahrung, keine rein objektive Widerspiegelung der Welt ist. Vielmehr handelt es sich um ein Konstrukt, das auf sensorischen Informationen basiert, die von unserem Gehirn verarbeitet werden.
Wir nähern uns einem Punkt, an dem rudimentäre Gedankenlesegeräte, die auf das Gehirn einer Person trainiert wurden, Annäherungen an unsere Gedanken liefern können. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem wir einen identischen digitalen Zwilling einer Person erstellen, der die Handlungen der ursprünglichen Person widerspiegelt. Dann zeigen wir der Person ein Livebild von sich selbst und ihrem digitalen Zwilling nebeneinander. Angesichts unserer grundlegenden Gedankenlesefähigkeiten bitten wir die Person, an eines von drei bestimmten Tieren zu denken. Unsere Fähigkeit, ihre Gedanken zu lesen, geben wir jedoch nicht preis.
Wenn die Person an ein Tier denkt, projizieren wir im Experiment ein Bild dieses Tieres über die Köpfe der beiden Personen. Über der tatsächlichen Person zeigen wir das entsprechende Tier, während wir über der simulierten Person ein anderes Tier zeigen.
Am Anfang hat das tatsächliche Spiegelbild mehr richtige Antworten als der Sim, aber das ändert sich mit der Zeit. Wir tun auch so, als müssten wir von der Testperson einen Knopf drücken, um zu bestätigen, ob unsere Vermutung richtig ist.
Jedes Mal, wenn der digitale Zwilling das Tier richtig identifiziert, drückt die Person einen Knopf. Auf diese Weise schaffen wir ein Szenario, in dem wir ihre Reaktionen überwachen, ohne unsere Gedankenlesefähigkeiten explizit preiszugeben.
In der ersten Phase des Experiments lassen wir die Person langsam glauben, sie sei der Zwilling der simulierten Person. Dann senken wir die Raumtemperatur langsam ab. Dadurch wird Schweiß auf der Stirn der simulierten Person sichtbar. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Was passiert mit der realen Person? Beginnt sie auch zu schwitzen? Besteht die Möglichkeit, dass sie aufgrund der Inkonsistenz zwischen der sinkenden Raumtemperatur und den visuellen Hinweisen (die simulierte Person schwitzt) Realitäts-/Reisekrankheit verspürt?
Wenn die Testperson die Vorstellung, dass ihre Identität in der simulierten Person verkörpert ist, voll und ganz akzeptiert, besteht der nächste Schritt darin, zu untersuchen, ob die simulierte Person die Gedanken der realen Person beeinflussen kann. Wenn die reale Person beispielsweise an einen Löwen denkt, wir aber über dem Kopf der simulierten Person eine Antilope anzeigen, wird die reale Person dann anfangen, an ihren eigenen Gedanken zu zweifeln und davon überzeugt sein, dass sie tatsächlich an eine Antilope gedacht hat?
Die Erkenntnisse zur Rubber Hand Illusion (RHI) legen nahe, dass das Gehirn im Vergleich zum Rest des zentralen Nervensystems keine besonderen Bewusstseinseigenschaften besitzt.
Man könnte sich eine Reihe von Experimenten vorstellen, die den berühmten Konformitätsexperimenten von Asch ähneln. Die grundlegende Frage in diesen Szenarien besteht darin, wie man das Gehirn so weit in die Simulation eintauchen lassen kann, dass es beginnt, seine eigenen Gedanken und Absichten zu hinterfragen, ohne dass dafür eine hochdetaillierte VR-Ausrüstung erforderlich ist.1
Wahre Geschichte
Was bedeutet es, wenn eine Geschichte wahr ist? Es bedeutet, dass die in der Geschichte beschriebenen Ereignisse tatsächlich in der realen Welt passiert sind, nicht in einer fiktiven. Wahre Geschichten basieren auf tatsächlichen Ereignissen und daher können nur wahre Geschichten falsch sein. Eine Geschichte über den Weihnachtsmann kann beispielsweise nicht falsch sein, da der Weihnachtsmann selbst nicht real ist.
Diese Vorstellung von Realität unterscheidet sich von dem, was Chalmers andeutet, wenn er sagt: „Der Weihnachtsmann und die Geister sind nicht real, aber die Geschichten über sie schon.“ Chalmers scheint die Realität in einem anderen Kontext zu betrachten und anzuerkennen, dass bestimmte Geschichten fiktiv sein können, auch wenn sie Elemente enthalten, die nicht real sind.
Stellen Sie sich eine Sortiermaschine vor, die in einem Buch die wahren Teile einer Geschichte von den erfundenen unterscheiden könnte. Um diese Unterscheidung vornehmen zu können, bräuchte man eine Referenztabelle namens „Menschheitsgeschichte“. Diese Tabelle würde es uns ermöglichen, den Inhalt des Buches mit vertrauenswürdigen Quellen zu vergleichen, um deren Authentizität zu überprüfen.
Chalmers schlägt fünf Kriterien vor, um zu testen, ob etwas real ist:
1. Es existiert.
2. Es hat kausale Kraft oder die Fähigkeit, etwas anderes geschehen zu lassen; es funktioniert.
3. Es entspricht dem Diktum von Philipp K. Dick, wonach die Realität bestehen bleibt, auch wenn man aufhört, an sie zu glauben. Sie wird nicht von dem Verstand beeinflusst, der sie wahrnimmt.
4. Es sieht ungefähr so aus, wie es scheint.
5. Es ist authentisch und entspricht Austins Diktum.
Chalmers räumt ein, dass diese Kriterien selbst vage und verschwommen sind. Er spekuliert, dass manche Dinge einen gewissen Grad an Realität haben könnten, was bedeutet, dass sie umso realer sind, je mehr Kriterien sie erfüllen. Dieses Konzept kann jedoch etwas enttäuschend sein, da es Definitionen einführt, die zu anderen komplexen philosophischen Fragen führen.
Unter Berücksichtigung aller Aspekte ist es überraschend, dass Chalmers das Konzept kontinuierlicher Realitätswerte nie vollständig akzeptiert. Die Realität scheint auf einem unscharfen Spektrum mit graduellen Werten zu existieren. Beispielsweise könnte etwas 80% real sein, je nachdem, wie gut es die aufgeführten Kriterien erfüllt. Dies führt zu Unsicherheit und macht es für zwei menschliche Gehirne schwierig, eine einstimmige Einigung darüber zu erzielen, was der Begriff „real“ wirklich bedeutet.
Der Begriff des Leidens
Das Hauptziel jeder wissenschaftlichen Simulation besteht darin, die Möglichkeit zu bieten, die Ergebnisse zu erleben, ohne ihre realen Konsequenzen ertragen zu müssen. Für fühlende Wesen ist die Realität eine Simulation, die echtes Leiden hervorruft. Es ist merkwürdig, dass in einem Buch, das für den Simulationsrealismus plädiert, kein einziger Glossareintrag dem Konzept des Leidens gewidmet ist, obwohl Chalmers Moral und Ethik durchaus berührt.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass selbst in unseren gegenwärtigen, unvollkommenen Simulationen bereits echtes Leid existiert. Denken Sie an Multiplayer-Spiele: Wenn Ihr Avatar wiederholt getötet wird, empfinden Sie echte Wut und Frustration. Wenn ein Mitglied Ihres Überfallstrupps seinen 10. legendären Gegenstand erhält, Sie aber keinen, empfinden Sie echte Eifersucht. Sie könnten argumentieren, dass Sie physisch überleben, wenn Ihr Avatar in Call of Duty in den Kopf geschossen wird, aber die Frustration, die dieses Ereignis verursacht, könnte das globale Leid stärker verstärken, als wenn ein echter Kopfschuss Ihr Leid sofort beenden würde.
Der Wissenschaftsphilosoph Karl Popper bestand darauf, dass das einzige Merkmal einer wissenschaftlichen Hypothese darin besteht, dass sie falsifizierbar ist, d. h. dass sie mit wissenschaftlichen Beweisen als falsch erwiesen werden kann. Die Simulationshypothese, die wir kennengelernt haben, ist jedoch nicht falsifizierbar, da alle Beweise gegen sie möglicherweise simuliert werden könnten. Daher würde Popper argumentieren, dass sie nicht als wissenschaftliche Hypothese gilt.
Viele zeitgenössische Philosophen sind der Ansicht, dass Poppers Kriterium zu streng ist. Es gibt wissenschaftliche Hypothesen, wie etwa jene über das frühe Universum, die aufgrund praktischer Einschränkungen niemals widerlegt werden können. Trotzdem neige ich dazu zu glauben, dass die Simulationshypothese nicht in den Bereich einer streng wissenschaftlichen Hypothese fällt. Sie liegt vielmehr an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlichen und philosophischen Bereichen.
Bestimmte Versionen der Simulationshypothese können empirischen Tests unterzogen werden, sodass sie mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht werden können. Es gibt jedoch andere Versionen der Hypothese, die von Natur aus nicht empirisch getestet werden können. Unabhängig von ihrer Testbarkeit bleibt die Simulationshypothese eine sinnvolle Aussage über unsere Welt. (Chalmers, S. 38)
Ich glaube nicht, dass Chalmers in diesem Absatz etwas erreicht. Zu sagen, dass etwas teilweise wissenschaftlich und teilweise philosophisch ist, schmälert den philosophischen Teil. Das ist, als würde man sagen, die Bibel sei teilweise historisch und teilweise fiktiv. Einige der im Buch beschriebenen Ereignisse können mit historischen Aufzeichnungen bewiesen oder widerlegt werden, wie der Auszug aus Ägypten, historische Personen wie König David oder Pontius Pilatus oder sogar Jesus aus Nazareth. Das würde jedoch wahren Gläubigen nicht genügen, die darauf bestehen, dass all die Magie und Wunder, die im Buch beschrieben werden, real sind oder waren. Sie glauben wirklich, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist und über das Wasser gegangen ist. Aus diesem Grund ist es sinnlos, wissenschaftliche Methoden anzuwenden, um sich mit all den heiligen Schriften zu befassen; es ist Zeitverschwendung, weil das Wesen des auf diesen Seiten beschriebenen Glaubenssystems die wissenschaftliche Methode nicht akzeptiert. Also, nein, die Teile der Simulationshypothese, die überprüfbar wären, sind nicht die interessanten. Im Kern der Simulationshypothese liegt ein philosophisches Argument, kein wissenschaftliches. Die Wissenschaft steht am Rand.
Wissen und Skepsis
Eine verbreitete, auf Platon zurückgehende Sichtweise von Wissen ist, dass Wissen gerechtfertigter, wahrer Glaube ist. Um etwas zu wissen, muss man denken, dass es wahr ist (das ist Glaube), man muss damit Recht haben (das ist Wahrheit) und man muss gute Gründe haben, es zu glauben (das ist Rechtfertigung). (Seite 44)
In der Philosophie ist ein Skeptiker jemand, der unsere Überzeugungen in einem bestimmten Bereich in Zweifel zieht (…) Die bösartigste Form des Skeptizismus ist der globale Skeptizismus, der alle unsere Überzeugungen gleichzeitig in Zweifel zieht. Der globale Skeptiker sagt, dass wir überhaupt nichts wissen können. Wir mögen viele Überzeugungen über die Welt haben, aber keine davon führt zu Wissen. (Seite 45)
Die Simulationshypothese mag einst eine phantasievolle Hypothese gewesen sein, aber sie entwickelt sich rasch zu einer ernsthaften Hypothese. Putnam stellte seine Idee des Gehirns im Tank als Science-Fiction-Stück vor. Doch seitdem haben sich Simulations- und VR-Technologien schnell weiterentwickelt, und es ist nicht schwer, einen Weg zu voll simulierten Welten zu erkennen, in denen manche Menschen ein Leben lang leben könnten. Infolgedessen ist die Simulationshypothese realistischer als die Hypothese des bösen Dämons. Wie der britische Philosoph Barry Dainton es ausgedrückt hat, ist die Bedrohung durch den Simulationsskepsis weitaus realer als die seiner Vorgänger. Descartes hätte die heutige Simulationshypothese zweifellos aus genau diesem Grund ernster genommen als seine Dämonenhypothese. Wir sollten sie auch ernster nehmen. (Seite 55)
Bertrand Russell sagte einmal, der Sinn der Philosophie bestehe darin, mit etwas so Einfachem zu beginnen, dass es nicht der Rede wert erscheint, und mit etwas so Paradoxem zu enden, dass es niemand glauben wird. (Seite 56)
An seinem Denken zu zweifeln ist in sich widersprüchlich: Das Zweifeln selbst zeigt, dass der Zweifel falsch ist. (Seite 59)
Von meiner Seite gibt es hier keine Einwände, der ganze Teil ist sehr gut zusammengestellt.
Idealistischer Widerspruch
Wir haben bereits einen Weg angesprochen, der zu der Schlussfolgerung führt, dass die Hypothese widersprüchlich ist, und der von Berkeleys Idealismus vorgeschlagen wird. Der Idealismus besagt, dass der Anschein die Realität ist. Eine starke Version des Idealismus besagt, dass, wenn wir sagen „wir befinden uns in einer Simulation“, dies lediglich bedeutet „es scheint, als ob wir uns in einer Simulation befinden“ oder etwas in dieser Art. Nun kann die Hypothese der perfekten Simulation so verstanden werden: „Wir befinden uns in einer Simulation, aber es scheint nicht, als ob wir uns in einer Simulation befinden.“ Wenn die starke Version des Idealismus wahr ist, ist dies gleichbedeutend mit „Wir befinden uns in einer Simulation und wir befinden uns nicht in einer Simulation“, was ein Widerspruch ist. Angesichts dieser Version des Idealismus können wir also wissen, dass die Simulationshypothese falsch ist. (Chalmers, S. 75)
Unser Verstand gibt der Realität Vorrang vor imaginären Dingen.
Realität ist das, was die Evolution uns aufzwingt.
Simulationen sind unsere Erfindungen, um den Güterzug zu verlangsamen und die Auswirkungen des Evolutionsdrucks abzufedern.
Die Realität ist das, was man nicht überspringen kann.
Wenn MLK vor einer Menge bei vollem Bewusstsein sagt: „Ich habe einen Traum“ … macht das seine ganze Rede nicht sehr unglaubwürdig? Nein – er verwendet den Traum als Metapher für den Blick in die Zukunft. Ein prophetischer Traum, von dem er sich wünscht, dass er Wirklichkeit wird.
Was ist Realität?
Virtuelle Dinge sind nicht real, lautet die Standardaussage zur virtuellen Realität. Ich halte das für falsch. Virtuelle Realität ist real, das heißt, die Entitäten in der virtuellen Realität existieren wirklich. Meine Ansicht ist eine Art virtueller Realismus. (…) So wie ich es verstehe, ist virtueller Realismus die These, dass virtuelle Realität echte Realität ist, ruf Mama an, mit Betonung insbesondere auf der Ansicht, dass virtuelle Objekte real und keine Illusion sind. Im Allgemeinen ist Realismus das Wort, das Philosophen für die Ansicht verwenden, dass etwas real ist. Jemand, der Moral für real hält, ist ein moralischer Realist. Jemand, der Farben für real hält, ist ein Farbrealist. Analog dazu ist jemand, der glaubt, dass virtuelle Objekte real sind, ein virtueller Realist. Ich akzeptiere auch den Simulationsrealismus: Wenn wir uns in einer Simulation befinden, sind die Objekte um uns herum real und keine Illusion. Virtueller Realismus ist eine Ansicht zur virtuellen Realität im Allgemeinen, während Simulationsrealismus eine Ansicht speziell zur Simulationshypothese ist. Simulationsrealismus besagt, dass die Katzen und Stühle in der Welt um uns herum wirklich existieren, auch wenn wir unser ganzes Leben in einer Simulation verbracht haben. Sie sind keine Illusionen; die Dinge sind so, wie sie scheinen. Das meiste, was wir in der Simulation glauben, ist wahr. Es sind echte Bäume und echte Autos, New York, Sydney, Donald Trump und Beyoncé – alles ist real. (…) Wenn wir den Simulationsrealismus akzeptieren, beantworten wir die Realitätsfrage mit Ja. In einer Simulation sind die Dinge real und keine Illusionen. Wenn das so ist, stellen die Simulationshypothese und verwandte Szenarien keine globale Bedrohung mehr für unser Wissen dar. Auch wenn wir nicht wissen, ob wir uns in einer Simulation befinden oder nicht, können wir dennoch viele Dinge über die Außenwelt wissen. Wenn wir uns in einer Simulation befinden, sind die Bäume und Autos und Beyoncé natürlich real. sind nicht genau so, wie wir dachten. Im Grunde gibt es einige Unterschiede. Wir dachten, dass Bäume, Autos und menschliche Körper letztlich aus Elementarteilchen wie Atomen und Quarks bestehen, anstatt dass sie aus Bits bestehen. Ich nenne diese Ansicht virtuellen Digitalismus. Virtueller Digitalismus besagt, dass Objekte in der virtuellen Realität digitale Objekte sind, grob gesagt Kommastrukturen binärer Informationen Komma Nachrufe Virtueller Digitalismus ist eine Version des virtuellen Realismus, da digitale Objekte vollkommen real sind. Bitstrukturen basieren auf realer Verarbeitung, auf einem realen Computer. Wenn wir uns in einer Simulation befinden, befindet sich der Computer metaphorisch gesprochen in der nächsten Welt. Aber die digitalen Objekte sind deswegen nicht weniger real. Wenn wir uns also in einer Simulation befinden, sind die Katzen, Bäume und Tische um uns herum alle vollkommen real. (Chalmers, S. 105)
Chalmers scheint eine Synthese aus Idealismus und Realismus anzustreben. Sein Gebrauch von „Realismus“ scheint klar, doch er stolpert subtil, wenn er sagt: „Wenn wir uns in einer Simulation befinden … sind die Dinge nicht genau so, wie wir dachten, dass sie wären.“ (Hier trübt das Ersetzen von „genau“ durch „wirklich“ schnell die Klarheit, die er zu wahren versucht hatte). Ich empfinde Chalmers nicht als absichtlich ausweichend; seine Bemühungen, das Konzept der Realität selbst innerhalb einer potenziellen Simulation zu bewahren, erscheinen mir etwas verzweifelt. Seine Argumentation tendiert letztendlich eher zur Theologie als zur Philosophie. Der Hauptunterschied zwischen einem Betrüger und einem wahren Gläubigen an Pseudorealitäten liegt in der gezielten Kontrollsphäre: Der erstere zielt darauf ab, andere zu manipulieren, während der letztere Selbstkontrolle anstrebt. In diesem Zusammenhang erweist sich Chalmers als wahrer Apostel. Daraus folgt logisch seine spätere Konstruktion einer Simulationstheologie in dem Buch.
Chalmers belastet Begriffe wie „Realität“, „Illusion“ und „Virtualität“ stark, vielleicht in der Hoffnung, dass diese semantische Schockbehandlung uns zu einer neuen Perspektive rüttelt.
Der große Tausch
 Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem jedes Kind nach der Geburt unwissentlich von seiner biologischen Mutter getrennt und mit einem anderen Kind vertauscht wird. Jeder wird von Fremden aufgezogen, die er als seine Eltern betrachtet, und diese Adoptiveltern, die ebenfalls nichts ahnen, nehmen das Kind als ihr eigenes an. Chalmers könnte in seiner Interpretation dieser hypothetischen Situation die Idee des „Beziehungsrealismus“ vorschlagen. Er würde argumentieren, dass alle Beteiligten, da sie einander als ihre wirkliche Familie behandeln, tatsächlich ihre wirkliche Familie sind. Chalmers könnte diese Argumentation sogar erweitern und vorschlagen, dass selbst wenn genetische Tests zeigen würden, dass die Personen, die wir für unsere Eltern halten, nicht unsere biologischen Eltern sind, sie im Grunde dennoch unsere wirklichen Eltern sind. Sie sind vielleicht nicht genau das, was wir ursprünglich dachten, aber die Liebe, die zwischen uns ausgetauscht wird, macht diese Beziehung real.
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem jedes Kind nach der Geburt unwissentlich von seiner biologischen Mutter getrennt und mit einem anderen Kind vertauscht wird. Jeder wird von Fremden aufgezogen, die er als seine Eltern betrachtet, und diese Adoptiveltern, die ebenfalls nichts ahnen, nehmen das Kind als ihr eigenes an. Chalmers könnte in seiner Interpretation dieser hypothetischen Situation die Idee des „Beziehungsrealismus“ vorschlagen. Er würde argumentieren, dass alle Beteiligten, da sie einander als ihre wirkliche Familie behandeln, tatsächlich ihre wirkliche Familie sind. Chalmers könnte diese Argumentation sogar erweitern und vorschlagen, dass selbst wenn genetische Tests zeigen würden, dass die Personen, die wir für unsere Eltern halten, nicht unsere biologischen Eltern sind, sie im Grunde dennoch unsere wirklichen Eltern sind. Sie sind vielleicht nicht genau das, was wir ursprünglich dachten, aber die Liebe, die zwischen uns ausgetauscht wird, macht diese Beziehung real.
In ähnlicher Weise scheint Chalmers die Tatsache zu umgehen, dass die Entdeckung, dass mein Vater nicht mein biologischer Vater ist, keine bedeutsamen Erkenntnisse liefert. Da ich seit meiner Geburt eine perfekte Simulation einer Beziehung mit meinen nicht biologischen Eltern lebe, sind sie keine falschen Eltern, sondern meine echten. Es ist bemerkenswert, dass diese Übung der Neudefinition und Überladung realitätsbezogener Begriffe nur dann amüsant ist, wenn man sie aus der Perspektive eines Außenstehenden betrachtet. Wenn Chalmers jedoch morgen aufwachen und feststellen würde, dass seine Erinnerungen an seine Zeit als berühmter australischer Philosoph, der ein Buch über Realitäten und Simulationen geschrieben hat, erfunden sind und dass er sich tatsächlich in einer Simulationsmaschine befindet, die ein Programm auf seinem digitalen Gehirn ausführt, bezweifle ich, dass er das amüsant finden würde.
Sisyphosische Zombies
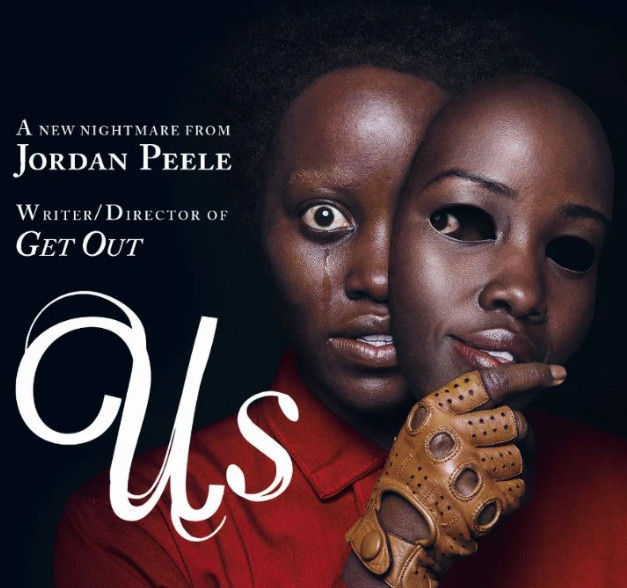
„Wir“ ist ein Psycho-Horrorfilm von Jordan Peele. Der Film erzählt die Geschichte der Familie Wilson, die auf eine Gruppe von Doppelgängern trifft, die genauso aussehen wie sie, aber finstere Absichten haben. Die Familie muss sich ihrer eigenen dunklen Vergangenheit stellen, während sie ums Überleben gegen ihre bedrohlichen und furchteinflößenden Gegenstücke kämpft. Im Laufe der Nacht kommen schaurige Geheimnisse ans Licht, die zu einer schockierenden Enthüllung über die wahre Natur dieser Doppelgänger und die verstörende Verbindung führen, die sie mit der Familie teilen.
Der Film bringt den Realitätssinn des Zuschauers völlig aus den Fugen und zeigt, wie sich das Konzept auf das Selbst und die Identität bezieht. Er stellt auch unsere Vorstellungen von Selbstkontrolle und freiem Willen in Frage.
Die Doppelgänger werden als „The Tethered“ bezeichnet. Die Erklärung, wie The Tethered erschaffen wurden, bleibt etwas zweideutig und offen für Interpretationen. Es wird jedoch vermutet, dass The Tethered das Ergebnis eines fehlgeschlagenen geheimen Regierungsexperiments sind.
Der Film deutet an, dass die Regierung die Bevölkerung kontrollieren wollte, indem sie Klone von Individuen schuf und sie in unterirdischen Einrichtungen einsperrte. Diese Klone, die Tethered, sind körperlich identisch mit ihren oberirdischen Gegenstücken, sind jedoch gezwungen, unter dunklen und bedrückenden Bedingungen zu leben, was das Leben ihrer Gegenstücke über der Erde widerspiegelt.
Mit der Zeit entwickeln die Tethered ein eigenes Bewusstsein und ein tiefes Gefühl von Groll und Rachegelüsten gegenüber ihren Gegenstücken an der Oberfläche. Schließlich steigen sie an die Oberfläche und beginnen eine gewalttätige Auseinandersetzung mit ihren Doppelgängern, um deren Platz in der Welt einzunehmen.
Ändern wir nun die Parameter der Umgebung leicht und statt hirnloser Zombies, die ziellos in Tunneln unter der Oberfläche umherlaufen, ist jeder Doppelgänger per VR per Fernzugriff mit seinem Gegenstück an der Oberfläche verbunden. Sie erleben alles durch die Sinneseindrücke ihrer Zwillinge, von der Geburt bis zum Sterbebett.
In seinem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ untersucht Albert Camus das Konzept des Absurden und verwendet dabei den griechischen Mythos des Sisyphos als Metapher. Sisyphos wurde von den Göttern bestraft und dazu verdammt, einen Felsbrocken einen Hügel hinaufzurollen, nur um dann zuzusehen, wie er wieder hinunterrollte, und diese Aufgabe für alle Ewigkeit zu wiederholen.
Camus argumentiert, dass Sisyphos selbst angesichts einer scheinbar sinnlosen und sich wiederholenden Existenz Glück finden kann, indem er die Absurdität seiner Situation akzeptiert. Trotz der Sinnlosigkeit seiner Bemühungen kann er durch seinen Akt des Trotzes gegen die Absurdität des Lebens seinen eigenen Sinn und Zweck entwickeln. Camus schlägt daher vor, dass wahres Glück darin zu finden ist, die Absurditäten des Lebens zu akzeptieren und anzunehmen, anstatt nach dem ultimativen Sinn oder Zweck zu suchen.
Der letzte Satz des Aufsatzes lautet:
„Man muss sich Sisyphos als glücklich vorstellen.“
In einer Wendung, die an den großen Camus erinnert, stellt Chalmers im Wesentlichen fest:
„Man muss sich die Simulation real vorstellen.“
Doch anders als der Existenzialist Camus, der die Absurdität einer solchen Aussage anerkennt und dennoch versucht, emotional damit umzugehen, versucht Chalmers, sich mit Argumenten herauszuwinden, und scheitert damit meiner Meinung nach.
Das Leben des VR-Doppelgängers ist laut Chalmers keine zweitklassige Realität. Es ist eine vollkommen gute und lebenswerte Simulation.
Ich nenne diesen neuen philosophischen Zombie einen sisyphosischen Zombie: einen Zombie, der glücklich darüber ist, keine Emotionen zu haben.
- Einige Monate später fand ich die Beschreibung dieses Experiments, das überzeugend dafür spricht, dass wir neurobiologisch darauf gepolt sind, uns durch äußere Reize leicht täuschen zu lassen und zu glauben, eine Entscheidung sei unser eigener Wille, obwohl dies nachweislich nicht der Fall ist:
Die Psychophysik zeigt, dass das Bewusstsein die meisten Handlungen nicht lenkt, sondern Berichte darüber verarbeitet, die von unbewussten Einheiten stammen, die die Arbeit verrichten. Mit einer Technik namens transkranielle Magnetstimulation (TMS) können je nach Ermessen des Experimentators die linken oder rechten motorischen Zentren im Gehirn einer Versuchsperson stimuliert werden. Ein richtig geformtes TMS-Signal an das rechte motorische Zentrum verursacht ein Zucken des linken Handgelenks, während ein richtig geformtes TMS-Signal an das linke motorische Zentrum ein Zucken des rechten Handgelenks verursacht. Alvaro Pascual-Leone hat diese Technik auf raffinierte Weise in einem einfachen Experiment mit tiefgreifenden Auswirkungen eingesetzt. Er bat die Versuchspersonen, auf ein Stichwort hin zu entscheiden, ob sie mit ihrem rechten oder ihrem linken Handgelenk zucken wollten. Dann wurden sie angewiesen, ihre Absicht auf ein weiteres Stichwort hin in die Tat umzusetzen. Die Versuchspersonen befanden sich in einem Gehirnscanner, sodass der Experimentator ihre motorischen Bereiche bei der Vorbereitung des Zuckens beobachten konnte. Hatten sie sich entschieden, mit ihrem rechten Handgelenk zu zucken, war ihr linker motorischer Bereich aktiv; Wenn sie beschlossen, ihr linkes Handgelenk zu bewegen, war ihr rechter motorischer Bereich aktiv. Auf diese Weise war es möglich, vorherzusagen, welche Wahl getroffen worden war, bevor irgendeine Bewegung stattfand. Nun kommt eine aufschlussreiche Wendung. Gelegentlich wendete Pascual-Leone ein TMS-Signal an, um die Wahl des Probanden zu widerlegen (und, wie sich herausstellte, zu überschreiben). Das Zucken des Probanden war dann das, das TMS ihm aufgezwungen hatte, und nicht das, das er oder sie ursprünglich gewählt hatte. Bemerkenswert ist, wie die Probanden erklärten, was geschehen war. Sie berichteten nicht, dass eine äußere Kraft von ihnen Besitz ergriffen hatte. Vielmehr sagten sie: „Ich habe meine Meinung geändert.“
Wilczek, Frank (2021-01-11T22:58:59.000). Fundamentals: Ten Keys to Reality (Englische Ausgabe).
. ↩︎